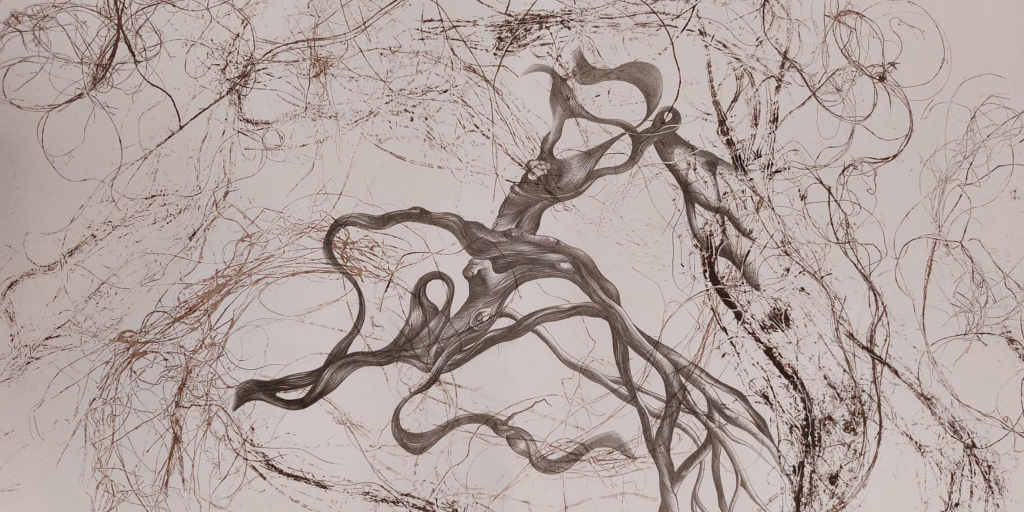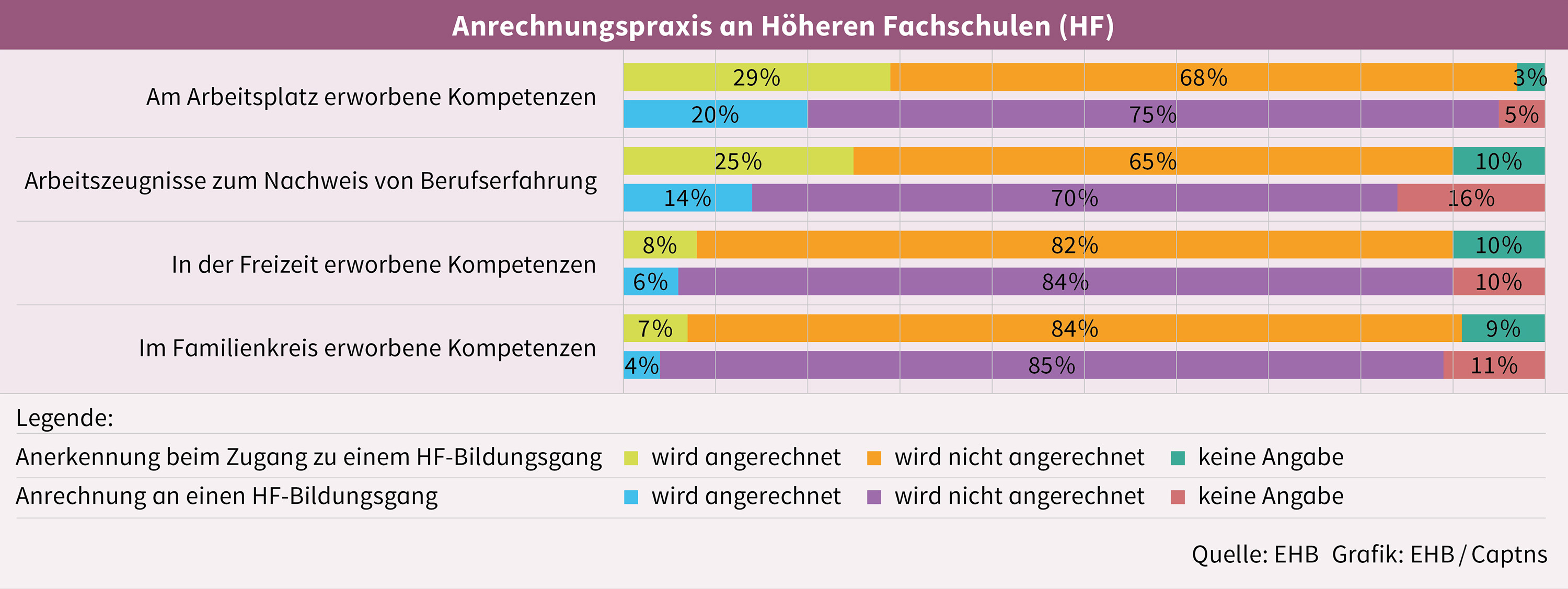Wie zufällig darf Lernen sein?
Das Interesse am informellen Lernen wächst mit dem Bedeutungsgewinn des lebenslangen Lernens. Was informelles Lernen dabei eigentlich beinhaltet, verschwimmt jedoch zunehmend.
Von Milan Glatzer und Antje Barabasch
Die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer und unsere Gesellschaft wird zunehmend zur Wissensgesellschaft. Das informelle Lernen – also das Lernen ausserhalb von Bildungsinstitutionen – hat dadurch eine gesellschaftspolitische Bedeutung erhalten.
Die erste bildungspolitische Auseinandersetzung mit informellem Lernen findet sich Anfang der 1970er-Jahre in Publikationen der UNESCO und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Seit der Jahrtausendwende widmet sich zunehmend die EU der Thematik. Dabei zeigt sich, dass sich das Verständnis von informellem Lernen verändert. Der Aspekt der Intentionalität von Lernaktivitäten rückt in den Fokus.
Zwei widersprüchliche Definitionen
Während in den Reformvorschlägen der UNESCO und der OECD zur Förderung des informellen Lernens noch idealistische Motive wie die Gestaltung demokratischer Gesellschaftsstrukturen und der Abbau sozialer Bildungsbarrieren zentral waren, betonen neuere Forschungsansätze der EU die Bedeutung des informellen Lernens fürs Berufsleben.
Diese Verlagerung spiegelt sich in unterschiedlichen Definitionen des informellen Lernens wider. So betont die OECD dessen zufälligen und nicht zielgerichteten Charakter: «Informelles Lernen wird niemals organisiert, ist nicht auf Lernergebnisse ausgerichtet und erfolgt aus der Sicht der/des Lernenden niemals absichtlich. Oft wird informelles Lernen als Erfahrungslernen oder schlicht als Erfahrung angesehen.»
Mehrere Forschungsprojekte der EU hingegen definieren informelles Lernen als «jede Aktivität, die das Streben nach Erkenntnissen, Wissen oder Fähigkeiten betrifft, das ohne extern vorgegebene Lehrplankriterien stattfindet». Der Begriff «Streben» ist hier wichtig. Die Intention zum Lernen ist für diese Definition zentral.
Zurück zum Ursprung
Bemerkenswert ist dabei, dass die Eingrenzung der EU auf intentionales Lernen dem Ansatz des Philosophen John Deweys widerspricht, der als Begründer des informellen Lernkonzeptes gilt und die Ansätze der UNESCO und OECD stark geprägt hat.
Dewey geht davon aus, dass Lernen erfahrungsbasiert und damit nicht zielgerichtet ist. Ausschlaggebend für eine Lernerfahrung sei es, einen Harmoniezustand mit der Umwelt zu erreichen, der durch Gefühle begleitet werde. Solche Gefühle ermöglichen einen «Akt konstruktiven Wirkens», was einen «Erkenntnisprozess» mit sich bringe. Erst durch Gefühle sei der Mensch imstande, etwas Erlebtes zu einer Erfahrung, «einem einmaligen Ganzen zusammen[zuführen]» und sein Wissen und seinen Handlungshorizont zu erweitern, schreibt er 1980 in seinem Werk «Kunst als Erfahrung». Dewey sieht informelles Lernen dabei nicht ausserhalb von Institutionen verortet, sondern plädiert dafür, es in diese einzubetten.
Lebenslanges Lernen als wissenschaftliches Credo
Es liegt nahe, dass der Fokus auf die Intentionalität an den bildungswissenschaftlichen Diskurs zu lebenslangem Lernen anschliesst. In diesem wird Lernen primär als ein vordefinierter Kompetenzerwerb verstanden, der eine Person beruflich weiterqualifiziert, und weniger als subjektiver Entfaltungsprozess.
So nachvollziehbar dieser Schritt sein mag, der Preis dafür scheint ein verschwommenes Verständnis von Lernprozessen zu sein. Es besteht die Gefahr, zu übersehen, dass Lernen für den Menschen sinnlich notwendig ist, und nicht nach den passenden Bedingungen für solche Lernprozesse zu fragen. Wenn die Erziehungswissenschaft ihre disziplinäre Selbstständigkeit stärken will, darf sie die Frage nach den Bedingungen dafür, wie Menschen ihr Potenzial entfalten können, nicht aus den Augen verlieren. Die Arbeiten von John Dewey mögen dabei als Orientierung dienlich sein.